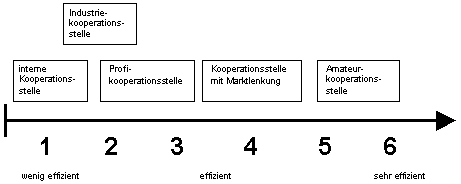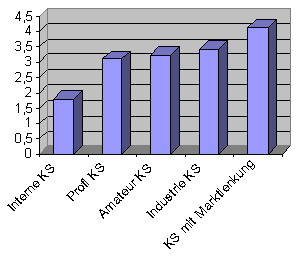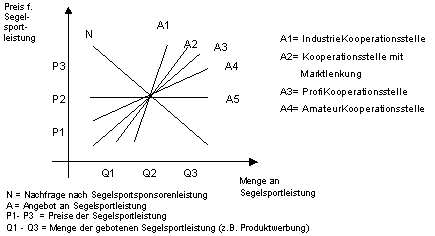Das Ergebnis
Die Bewertung der jeder KS erfolgt mit absoluten Zahlen für jedes Effizienzkriterium.
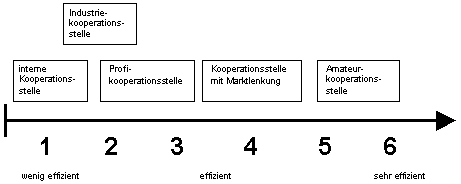
(Abb.: Sportliche Effizienz, Stärken/Schwächen)
Insgesamt werden dann die absoluten Zahlen der einzelnen Effizienzkriterien addiert und ein Durchschnittswert gebildet.
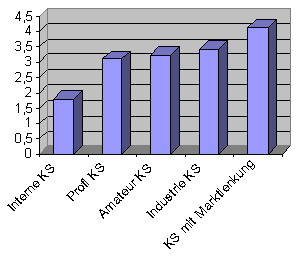
Die interne Kooperationsstelle hat den niedrigsten Vergleichswert. Durch ihre starke personelle Integration in den Verband zeigen sich entscheidende Vorteile nur bei den geringen Kosten der Ingangsetzung und den Unterhaltskosten.
Dies ist wohl der Grund, weshalb diese Kooperationsstellenform momentan zum Einsatz kommt.
Betrachtet man die im Vergleich dazu entgangenen Erträge, so ist es fraglich, ob diese Vorgehensweise des Verbandes richtig ist.
Mit einem deutlich positiveren Ergebnis schneidet die Profikooperationsstelle ab. Bedingt durch den Einsatz von Profis ist sie sehr kostspielig und erreicht in allen weiteren Kriterien nur durchschnittliche Punktzahlen. Der Einsatz von Profis führt zwar zu einer der höchsten Punktzahlen in der sportlichen Effizienz, garantiert aber keine gute Zusammenarbeit mit dem Segelsport.
Im Gesamtvergleich besser bewertet wird die Amateurkooperationsstelle. Sie erreicht hohe Bewertungszahlen in den Bereichen intrinsische Motivation, sportliche Effizienz und den Kosten der Ingangsetzung und des Unterhaltes.
Die Industriekooperationsstelle orientiert sich an einem in vielen anderen Sportarten schon erfolgreich durchgeführten Modell. Hohe Punktzahlen in den Bereichen kommerzielle Effizienz und Ressourceneffizienz resultieren aus der strengen Gewinnorientierung dieser Kooperationsstellenform. Sie überwiegen sogar die relativen Vorteile der anderen Kooperationsstellen, die in der Berücksichtigung sportlicher und motivationsbedingter Interessen liegen.
Es ist folglich ein bewährtes Konzept, welches Gefahren mit sich bringt. Initiative von außen und wenig Kontrollinstrumente innerhalb des Segelsports bewirken eine mögliche Abkopplung von Amateur- und Profisegelsport.
Dem großen Vorteil der Unabhängigkeit von Verbandsinteressen steht ein Verlust an Souveränität gegenüber.
Einen Ausweg bietet hier die Kooperationsstelle mit Marktlenkung. Ihre Punktzahlen sind selten so hoch, dass sie in einem Effizienzkriterium als absoluter Spitzenreiter erscheint. Sie erreicht eine gleichmäßig hohe Bewertung in allen Bereichen.
Aufbau und Funktionsweise sollen zahlreichen Interessen dienen. Besonders hervorzuheben ist der Gedanke einer breiten Finanzierungsbasis. Die anderen Kooperationsstellenformen finanzieren sich hauptsächlich durch die Unterstützung der initiierenden Gruppe.
Im Gegensatz dazu steht die Kooperationsstelle mit Marktlenkung. Sie integriert Kunden und Anbieter gleichermaßen in ihr Konzept. Dies führt in beiden Motivationskriterien zu guten Ergebnissen.
Bis ein solcher Kooperationsstellentyp allerdings Marktreife besitzt, muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das Modell scheint zwar seiner Zeit weit
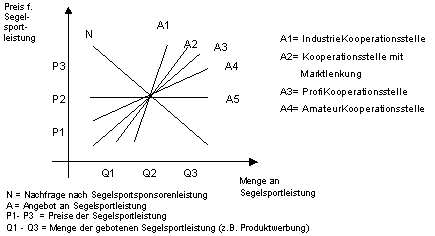
(Abb.: Differenziertes Preisverhalten des Segelsports bei einem Angebot durch verschiedenen Kooperationsstellen)
voraus zu sein, entspricht aber den in der Industrie verfolgten Mustern. Bei der derzeitigen Interessenlage im Verband muss das Ziel sein, eine Lösung mit einer hohen Integrationsfunktion zu finden.
Bei der Betrachtung der im Gesamtmarkt vorhandenen Angebots- und Nachfragefunktionen fällt der Handlungsbedarf, der zur Zeit besteht, unmittelbar ins Auge.
Schon die für den Verband kostengünstigste Alternative (A4) bedeutet eine positive Veränderung.
Wie schon im vorangehenden Vergleich beschrieben, kann die Industriekooperationsstelle (A1) schnell zu einer "Ausbeutung" des Segelsports führen. Die Gefahr der Ausbeutung von Sportlern und Nachfragern durch eine Kooperationsstelle ist immer dann gegeben, wenn sie eine Monopolstellung einnimmt. Da diese von anderen Anbietern wahrgenommen wird, werden sich Nachahmer finden, die Gewinne erzielen möchten und damit das vorhandene Monolpol beseitigen. Passiert dies nicht, muss die Monopolstellung durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen verhindert oder beseitigt werden.
Dafür sind bei einem unternehmerischen Auftreten neben Satzungen auch einschlägige Gesetze (z.B. Kartellgesetz) heranzuziehen.
Da der Markt im Segelsport in Deutschland sehr überschaubar ist, kann jede Initiative dazu führen, dass durch sie die Nachfrage geweckt wird. Dieser Vorteil entsteht dann, wenn man in einem noch nicht bearbeiteten jungen Markt aktiv wird.
Die vorgangegangene Untersuchung zeigt, dass eine Initiative erfolgversprechend ist. Zu viele Unternehmen (BMW, Mercedes, RTL) sind schon mit einem unprofessionell agierenden Segelsport zusammengetroffen. Unternehmen können es sich weniger denn je leisten in einen Sport zu investieren in dem der Erfolg nur fraglich ist. Der Segelsport selber läuft aber ebenso Gefahr in seinem derzeitigen Zustand zu verharren.
Dies mag für Traditionalisten und Einzelgänger erstrebenswert erscheinen, nicht aber für die Sportler deren Zukunft von diesen Entwicklungen abhängt.
Das neue Wege auch im Sport machbar sind zeigen kommerziell agierende Sportarten wie der Fußballsport.
Das auch hier Fehler gemacht werden, die es zu vermeiden gilt zeigt der Tennissport. Gestern noch Medienwirksam und begehrt, heute mit niedrigen Einschaltquoten und mit der drohenden Gefahr sportlich zweitklassig zu werden.